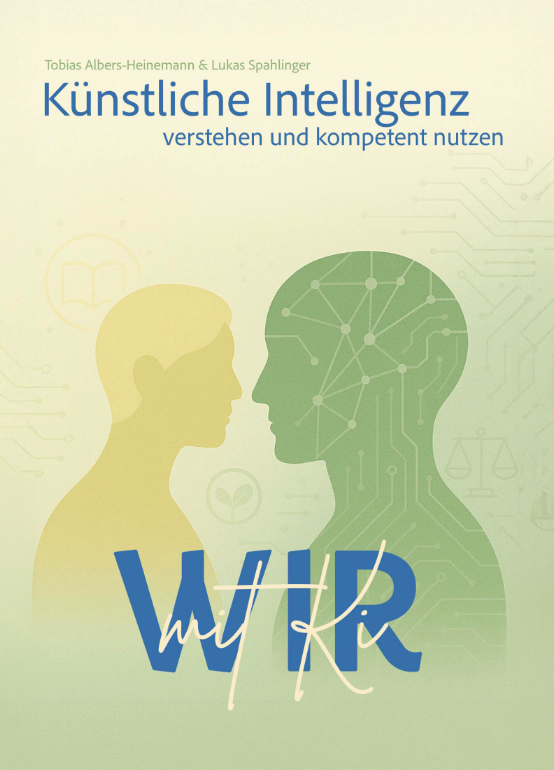
Ein Beitrag von Tobias Albers-Heinemann und Lukas Spahlinger
Digitale Technologien verändern unseren Alltag, unsere Arbeit und unsere Kommunikation in rasantem Tempo – und wir alle spüren in unserer täglichen Arbeit, wie tiefgreifend diese Digitalisierungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Arbeitsabläufe, Kommunikationswege und Lernformate verändern sich kontinuierlich. Wir bewegen uns dabei zwischen dem Staunen über täglich neu erscheinende KI-Tools und deren beeindruckende Möglichkeiten auf der einen Seite sowie Sorgen oder Ängsten vor
Datenschutzproblemen und ungewollten Veränderungen von Arbeitsprozessen oder dem Wegfall ganzer Arbeitsfelder auf der anderen.
In der aktuellen Debatte um Künstliche Intelligenz (KI) entsteht zudem oft der Eindruck, es handele sich – ähnlich wie bei Apps und Social-Media-Diensten wie WhatsApp, TikTok, Instagram oder Snapchat – um eine Frage des persönlichen Nutzens oder Nicht-Nutzens. Doch dieser Vergleich greift zu kurz: Künstliche Intelligenz durchdringt als Form der Digitalisierung so viele Ebenen unseres Alltags, dass wir ihr häufig begegnen, ohne es
überhaupt zu wissen. Es stellt sich also gar nicht die oft diskutierte Frage, ob wir KI nutzen wollen oder nicht, sondern vielmehr wie wir sie nutzen wollen und welche Rolle sie einnehmen soll.
Die Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren von einer Nischentechnologie zu einem prägenden Thema entwickelt, das aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken ist. Damit verbunden stellt sich nicht nur die Frage nach unserer persönlichen Haltung, sondern auch nach der Verantwortung der Bildungsakteure. Unabhängig von unserem Kompetenz- und Kenntnisstand müssen wir uns als mündige Bürgerinnen einer digitalisierten Gesellschaft darin positionieren – auf der individuellen Ebene ebenso wie in professionellen Kontexten. Auf der persönlichen Ebene betrifft dies unser alltägliches Leben – ob wir es bewusst wahrnehmen oder nicht, sei es durch die Integration von KI in unsere Smartphones, in Online-Dienste wie die Google-Suche, in smarte Gegenstände zu Hause oder aber auch in Bewerbungsverfahren, Kreditvergabesystemen oder Telefonhotlines. Zugleich stehen die Akteurinnen im Bildungsbereich in besonderer Verantwortung, Menschen auf diese umfassenden Entwicklungen vorzubereiten und Räume für
Auseinandersetzung zu schaffen.
Zudem verpflichtet seit Februar 2025 die Europäische KI-
Verordnung in Artikel 4 KI-nutzende Einrichtungen dazu, KI-Kompetenz systematisch zu vermitteln, was zusätzliche institutionelle Anforderungen formuliert. KI-Kompetenz meint dabei weit mehr als eine bloße Klickanleitung für populäre KI-Dienste.
Sie umfasst sowohl ein grundlegendes technisches Verständnis und die Fähigkeit, Funktionsweisen kritisch einzuordnen, als auch die Kompetenz, Chancen und Risiken zu
bewerten, gesellschaftliche und ethische Fragen zu reflektieren sowie KI verantwortungsvoll in der eigenen Arbeit einzusetzen.
Aus dem Inhaltsverzeichnis
- Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz
- KI, Vorurteile und Verantwortung – Wie wir KI diskriminierungssensibel nutzen können
- Künstliche Intelligenz und der Datenschutz
- KI, Urheberrecht und Kennzeichnungspflicht
- Menschsein im KI-Zeitalter – Bildungsaufgaben angesichts eines veränderten Menschenbilds
- Von piepsenden Tamagotchis und redseligen Robotern: eine kleine Geschichte der Mensch-Maschine-
Interaktion - Vertrauen, Beziehung und Reflexion: Medienpsychologische Perspektiven für die KI-Kompetenzbildung
- Künstliche Intelligenz in der Familie
- Künstliche Intelligenz und Einsamkeit
- Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit – Eine Perspektive der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Digitaler Kolonialismus, globale Gerechtigkeit und Künstliche Intelligenz
- Das Prinzip Barrierearmut – KI als Gestaltungsfaktor für Teilhabe
- Lokale KI-Modelle und Open Source: Chancen, Grenzen und Relevanz für die Bildung
- Prüfungsformate im Zeitalter von KI
- KI-Methoden in der Bildungsarbeit
- Ausblick: KI-Kompetenz in Zeiten gesellschaftlicher Transformation